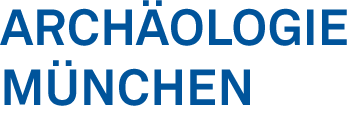F.A.Q.
Die häufigsten Fragen
Seit Projektgründung 2013 wurde der Fokus vor allem auf die Erforschung der Münchner Altstadt, also den Bereich innerhalb bzw. nahe der zwei Stadtumfassungen, gelegt. Schwerpunkt waren hierbei die Grabungen am Marienhof.
Seit der Verlängerung 2023 sieht die Projektplanung vor, dass verstärkt auch Grabungen in den übrigen Stadtbezirken bearbeitet und für die Öffentlichkeit erschlossen werden. Gerade die intensive Bautätigkeit wie beispielsweise im neuen Wohnquartier in Freiham bedingt umfangreiche archäologische Voruntersuchungen.
Es ist – insbesondere bei Großprojekten – sinnvoll, archäologische Bodendenkmäler vor dem Beginn der eigentlichen Bauarbeiten freizulegen und zu dokumentieren, um die viel höheren Kosten eines Baustopps und damit auch einer Bauverzögerung zu vermeiden. Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden stellt sicher, dass die archäologischen Maßnahmen in der Planung des Gesamtprojekts mit einbezogen werden.
Für Bodendenkmäler ist in Art. 7 BayDSchG (Ausgraben von Bodendenkmälern) festgelegt: „Wer auf einem Grundstück nach Bodendenkmälern graben oder zu einem anderen Zweck Erdarbeiten auf einem Grundstück vornehmen will, obwohl er weiß oder vermutet oder den Umständen nach annehmen muss, dass sich dort Bodendenkmäler befinden, bedarf der Erlaubnis.“
Diese sogenannte denkmalschutzrechtliche Erlaubnis erteilt die Untere Denkmalschutzbehörde des jeweiligen Landkreises bzw. der jeweiligen kreisfreien Stadt: Eine rechtlich belastbare, sachgerechte Abwägung der verschiedenen betroffenen öffentlichen Belange liegt in ihrer Zuständigkeit und in ihrem Ermessen. Bevor die Untere Denkmalschutzbehörde über den Erlaubnisantrag entscheidet, holt sie in der Regel die fachliche Stellungnahme des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege ein.
Ausführlichere Informationen finden Sie auf den Seiten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege.

Die gesamte Münchner Altstadt ist – in ihren baulichen Grenzen bis um 1800 – im Bayerischen Denkmal-Atlas als Bodendenkmal verzeichnet. Um das denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren zu beschleunigen und Planungssicherheit für Bauherren zu schaffen, wurde auf Initiative der Unteren Denkmalschutzbehörde und Dr. Christian Behrer (Büro für Denkmalpflege Regensburg) für die Münchner Innenstadt ein Archäologischer Stadtkataster erstellt.
Der Kataster ist eine wichtige Serviceleistung der Stadt für alle Bauherren und Planer und erleichtert die bodendenkmalpflegerische Betreuung der Münchner Altstadt erheblich. Er hilft, Verzögerungen durch überraschend auftretende archäologische Funde zu vermeiden.
Ein denkmalrechtliches Erlaubnisverfahren mit detaillierter Fachprüfung ist in allen Bereichen der Altstadt dennoch erforderlich – unabhängig davon, ob es sich um ein privates, kommunales oder staatliches Bauvorhaben handelt, und ob die jeweilige Fläche positiv oder negativ kartiert ist.
Zum Vertiefen in die Thematik finden Sie hier einen Artikel von Jochen Haberstroh zum Archäologischen Stadtkataster als Planungsinstrument.
In der Archäologie unterscheidet man prinzipiell zwischen Funden (bewegliche Gegenstände, Artefakte) und Befunden (unbewegliche Strukturen wie z.B. Verfärbungen des Bodens und Baustrukturen). Die Befunde werden freigelegt, eingemessen, mit Fotos und Zeichnungen bestmöglich nach streng festgelegten Standards durch zertifizierte Firmen dokumentiert und beschrieben. Letztendlich führt die Ausgrabung zu einer "kontrollierten Zerstörung", bietet gleichzeitig jedoch die einmalige Chance, die verborgenen Bodendenkmäler wissenschaftlich zu erfassen. Die Funde dagegen werden geborgen und in der Archäologischen Staatssammlung in München konserviert, restauriert und verwahrt. Menschliche Überreste gelangen in die Staatssammlung für Anthropologie, Tierknochen in die Staatssammlung für Paläoanatomie, beides Einrichtungen der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns (SNSB).
Wir präsentieren regelmäßig Aspekte und Ergebnisse aus den laufenden Forschungen in unterschiedlichen Formaten und an unterschiedlichen Standorten in der Stadt. Eine größere Sonderausstellung ist in Planung.
Auch in der 2024 wiedereröffneten, neuen Dauerausstellung der Archäologischen Staatssammlung ist die Stadtarchäologie prominent vertreten. Für alle, die das Bairische lieben, empfehlen wir unsere Schmankerl-Tour: Auf dieser Spezialtour entführt Sie die bekannte Kabarettistin und Komödiantin Luise Kinseher zu den außergewöhnlichsten Funden und Geschichten aus der Vorzeit Münchens – mit einem „Augenzwinkern“ und viel Humor. Lernen Sie die "Älteste Münchnerin" kennen und erfahren Sie, warum Bier in Bayern nicht immer ein Verkaufsschlager war. Bestaunen Sie ein 3.200 Jahre altes Bronzeschwert aus der Isar, und tauchen Sie ein in die alte Kaffeehaus-Kultur Münchens.
Der Arbeitsgemeinschaft Archäologie München gehören Experten aus vielen Bereichen an. Sie befassen sich mit der Archäologie und Geschichte der Landeshauptstadt, ihrer Erforschung und Präsentation. Die Projektleitung liegt bei der Archäologischen Staatssammlung, hier werden die Funde im Eigentum des Freistaates Bayern verwahrt, restauriert, inventarisiert, erforscht und für Forschungs- und Ausstellungszwecke zur Verfügung gestellt. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege als zentrale Fachbehörde des Freistaates Bayern für Denkmalschutz und Denkmalpflege ist in Zusammenarbeit mit der Unteren Denkmalschutzbehörde für die Bodendenkmäler zuständig. Gemeinsames Ziel ist deren Erhalt vor Ort oder ihre qualifizierte Ausgrabung und Dokumentation nach anerkannten fachlichen Vorgaben. Das Landesamt berät und betreut diese archäologischen Ausgrabungen. Die Untere Denkmalschutzbehörde, Referat für Stadtplanung und Bauordnung, ist der Ansprechpartner für alle denkmalrechtlichen Verfahren und betreut die Bauherren. Weitere Projektpartner sind das Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Ludwig-Maximilians-Universität, in dem auch zu stadtarchäologischen Themen geforscht wird. Das Münchner Stadtmuseum besitzt umfangreiche Sammlungen und führt Ausstellungen zu Münchner Themen durch. Im Stadtarchiv München wird die städtische Verwaltungsüberlieferung verwahrt und stadtgeschichtliche Forschungsarbeit geleistet. In der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie München werden die tierischen Reste aus den archäologischen Ausgrabungen aufbewahrt und bearbeitet. Im Institut für Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin wiederum werden diese Reste vor dem Hintergrund der Mensch-Tier-Beziehungen archäozoologisch untersucht. Das Büro für Denkmalpflege ist mit Christian Behrer als bestem Kenner der Archäologie Münchens in der Arbeitsgemeinschaft tätig. Details zu den Projektpartnern finden Sie hier.
Die im Denkmal-Atlas erfassten bayerischen Denkmaldaten finden sich seit Anfang 2014 durch eine Kooperation mit der Vermessungsverwaltung im sog. "Bayern-Atlas". Dieser zeichnet sich durch eine aktuelle, moderne Menüführung und detaillierte kartographische Darstellung aus. Neben historischen Karten, Luftbildern, Darstellungen der Flurstückgrenzen sowie der Überlagerung mit anderen Kartenwerken ist eine Verschneidung mit zahlreichen, weiteren Fachinformationen möglich. Hier geht's direkt zum Bayern-Atlas Denkmal.
Die Arbeit ist nach der Grabung längst nicht zu Ende. Zuerst kommen die geborgenen Funde in das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. Dort werden sie anhand von Listen und beigefügten Fundzetteln auf Vollständigkeit kontrolliert und konservatorisch erstversorgt. Frisch geborgene Objekte – insbesondere jene aus Metall – sind in ihrer Form und Funktion zunächst kaum zuordenbar und müssen bestimmt werden. Nach ihrer Übergabe in die Archäologische Staatssammlung werden die Objekte restauriert. Dies geschieht zunächst nur an einer sorgfältig getroffenen Auswahl, denn aus überwiegend finanziellen Gründen können nicht sämtliche Objekte sofort nach der Grabung restauriert werden. Schließlich werden die Funde in den Depots unter materialschonenden Standards gelagert, insbesondere das Klima wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur spielen dabei eine wichtige Rolle. Auch Probleme bei der Klärung von Eigentumsverhältnissen können zu Verzögerungen führen. Dabei erleiden viele Objekte auch großen Substanzverlust, bevor sie – oft nach mehreren Jahren – in die Obhut der Archäologischen Staatssammlung München gelangen.
Der Inhaber der denkmalrechtlichen Erlaubnis – zumeist also der Bauherr oder die Baufirma – trägt nach ständiger Rechtsprechung die Kosten. Staatliche Förderungsmöglichkeiten bestehen für besondere Maßnahmen zum Denkmalerhalt.
Über 70.000 Einzelobjekte wurden bisher geborgen. Sämtliche Funde wurden gereinigt, verpackt und mit Fundzetteln versehen, um sie später dem jeweiligen Fundort wieder zuordnen zu können. Eine Menge Arbeit, die auf die Forscherinnen und Forscher wartet!
Artikel 8 des Denkmalschutzgesetzes schreibt vor, dass alle Funde dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen sind. Dies gilt natürlich auch für alle im Gelände noch sichtbaren Bodendenkmäler und alle Beobachtungen, die auf Bodendenkmäler hinweisen können. Bitte wenden Sie sich bei Anfragen Bayern betreffend nicht an das Projekt oder die Archäologische Staatssammlung, sondern an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. Seine archäologisch geschulten Mitarbeiter können die Funde in aller Regel gleich bestimmen, Beobachtungen interpretieren und nach fehlenden Angaben zu Fundort und Fundumständen fragen.